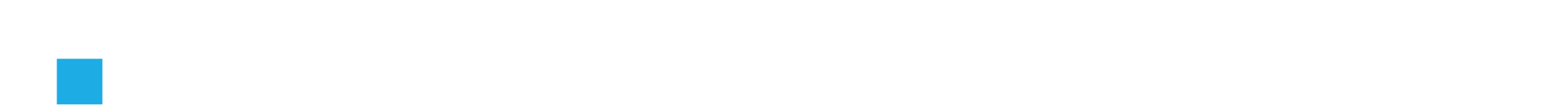Verbraucher fordern in alle Industrien nachhaltige Lösungen, während immer strengere Vorschriften eine ressourceneffiziente Produktion verlangen, dadurch steht auch die Verpackungsindustrie vor einer doppelten Herausforderung. Wie können Unternehmen diese Erwartungen erfüllen und zugleich Transparenz über die gesamte Lieferkette schaffen? Der Digital Product Passport (DPP) könnte die Antwort sein. Doch wie funktioniert dieser in der Praxis und welche Chancen bietet er der Branche? In einem Projekt mit der offenen Plattform für Rückverfolgbarkeit und DPP R-Cycle und dem Verarbeiter flexibler Verpackungen Korozo Group hat Henkel gezeigt, welche Vorteile sich erzielen lassen.
Der Druck, umweltverträgliche und ressourceneffiziente Verpackungen zu entwickeln, ist spürbar gestiegen. Gleichzeitig erfordern globale Lieferketten eine höhere Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um die Herkunft der Materialien, deren Verarbeitung und das Ende des Lebenszyklus nachvollziehbar zu machen.
Ein zentraler Trend in der Verpackungsindustrie ist die Entwicklung hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Ziel ist es, Verpackungen nicht nur effizienter zu gestalten, sondern sie am Ende ihres Lebenszyklus wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen. Dazu müssen die Materialien recycelbar sein und die verwendeten Rohstoffe möglichst aus nachhaltigen Quellen stammen. Darüber hinaus muss es klare Regeln für die Entsorgung geben. Um diese Anforderungen zu erfüllen, werden digitale Lösungen immer wichtiger.
Digital Product Passport treibt Transparenz voran
Vor diesem Hintergrund rückt der Digital Product Passport (DPP) in den Fokus. Er ist ein zentrales Instrument, um die notwendigen Informationen über die Zusammensetzung, den Lebenszyklus und die Nachhaltigkeitsaspekte eines Produktes digital zu erfassen und zugänglich zu machen. Getrieben durch regulatorische Anforderungen wie die Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) der Europäischen Union wird der DPP ab 2027 in vielen Branchen verpflichtend werden.
Der digitale Datensatz enthält Informationen wie Materialzusammensetzung, technische Spezifikationen und Recyclingfähigkeit eines Produkts. Jedes Produkt erhält eine eindeutige Identifikation, oft über QR-Codes oder RFID-Tags, die eine einfache Rückverfolgung entlang der Wertschöpfungskette ermöglichen. Entscheidend dafür ist die Qualität der erhobenen Daten. Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette müssen relevante Informationen liefern, die in einem standardisierten Format aufbereitet und für alle Akteure zugänglich sind.
Wandel bei Prozessen und Materialien mitgestalten
„Wir sind auf dem besten Weg, jedem Kunden ein nachhaltiges Produkt anbieten zu können, das entweder aus nachhaltigen Quellen stammt oder ein hervorragendes Recyclingprofil aufweist“, erklärt Philippe Blank. Als Lieferant und Markeninhaber ist Henkel in der einzigartigen Lage, einen großen Teil der Wertschöpfungskette abzudecken. „80 Prozent des ökologischen Fußabdrucks eines Produkts werden in der Designphase festgelegt. Wir nutzen unser Wissen, um unsere Kunden frühzeitig zu beraten.“
Insbesondere der Product Carbon Footprint (PCF) einzelner Komponenten und des gesamten Produkts spielt dabei eine entscheidende Rolle. Hier hat Henkel umfangreiche Kapazitäten aufgebaut, um Einsparpotenziale zu identifizieren und verlässliche Daten für digitale Produktpässe und Berichtsanforderungen bereitzustellen. Diese Daten sind besonders relevant im Hinblick auf die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und die Verpflichtung, recycelte Inhaltsstoffe zu verwenden.
„Wir orientieren uns an führenden Bewertungsmethoden und Designrichtlinien und arbeiten aktiv an neuen Testmethoden“, sagt Philippe Blank. Die Verpackungsindustrie durchläuft derzeit einen tiefgreifenden Wandel, der zu erheblichen Materialverschiebungen führt. Diese Veränderungen wirken sich auch auf die bestehenden Recyclingverfahren aus. Diese Lücken gilt es durch aktive Forschung und Entwicklung neuer Prüfmethoden zu schließen, um sich selbst und seine Kunden auf kommende gesetzliche Änderungen vorzubereiten.
Innovation und Nachhaltigkeit
„Wir sehen im DPP die große Chance, die Kreislaufwirtschaft durch bessere Recyclinginformationen zu fördern, die Transparenz in der Lieferkette zu steigern und das Vertrauen unserer Kunden und Partner in unsere Produkte zu stärken“, resümiert Philippe Blank. In den kommenden Jahren wird dem DPP eine zentrale Rolle in der Verpackungsindustrie als wichtiger Hebel von Innovationen und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zukommen. Neben der nachhaltigen Produktentwicklung ermöglicht es der DPP, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auf Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft aufbauen.